INSTITUT |
DIE Ethikleitlinien des Heidelberger Instituts für Tiefenpsychologie e.V. (HIT)
Auf der Mitgliederversammlung des HIT wurden folgende Vertrauensleute als Ansprechpartner gewählt:
Herr Dipl.-Psych. Daniel Nakhla
sowie
Frau Dr. Edeltraud Tilch-Bauschke
Kontaktdaten und weitere Infos finden Sie hier
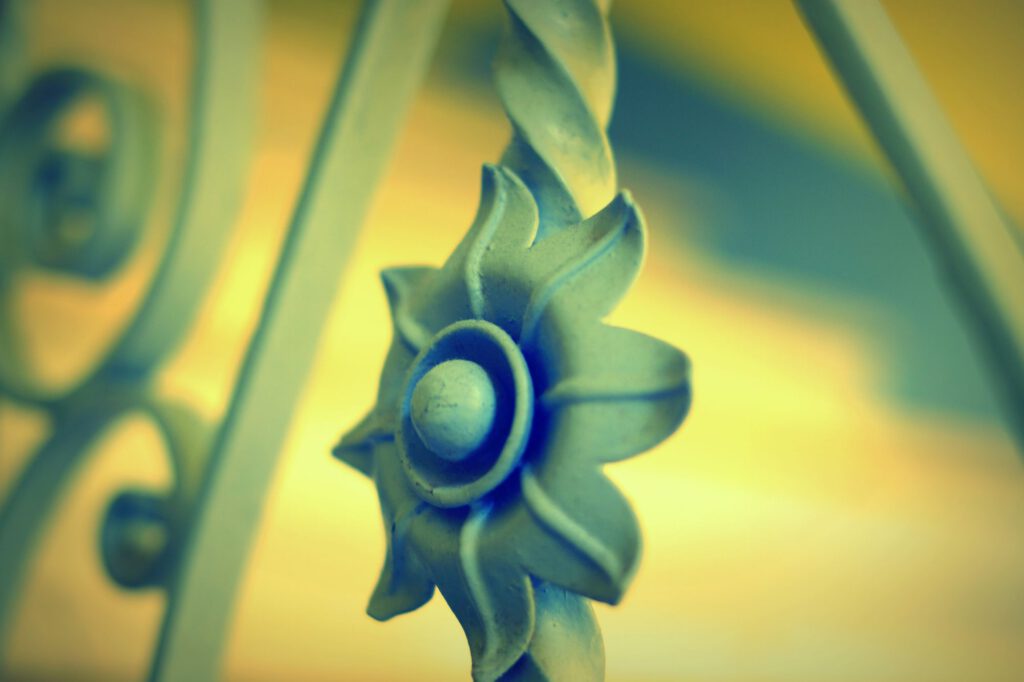
Wir orientieren uns an den Ethikrichtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse und Tiefenpsychologie (DGPT), der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV), den Ethikrichtlinien der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie e.V. (DGSF) sowie den Ethikleitlinien des Instituts für Psychoanalyse und Psychotherapie Heidelberg-Mannheim e.V. (IPP).
Präambel
Das HIT ist bemüht, eine hoch qualifizierte Weiterbildung zu gewährleisten und strebt deshalb ein hohes Maß an Professionalität und Qualitätssicherung an. Dazu gehört auch die Einhaltung von Weiterbildungs- und Ausübungsstandards in der psychotherapeutischen Arbeit. Die nachfolgenden ethischen Leitlinien des HIT sollen die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung als Therapeut, Supervisor, Ausbilder sowie als Aus- und Weiterbildungsteilnehmer unterstützen. Dies verstehen wir als einen ständigen Prozess der Rückbesinnung, Bewertung und Abwägung von Grundsätzen, Normen, Werten, Standards und Interessen im Rahmen der psychotherapeutischen Berufstätigkeit. So wird allen mit dem HIT assoziierten Personen eine Orientierungshilfe für ihre berufliche Identität und ihr professionelles Selbstverständnis sowie für die entsprechende Umsetzung in der supervisorischen und didaktischen Arbeit geboten. Die HIT-Ethikleitlinien ergänzen die HIT-Weiterbildungsrichtlinien sowie die Verträge von Teilnehmer, Dozent, Supervisor und Selbsterfahrungsleiter.
Zur Sicherung ihrer professionellen Kompetenz verpflichten sich die Aus- und Weiterbildungsteilnehmer sowie die Dozenten, Supervisoren und Selbsterfahrungsleiter des HIT zur Einhaltung der folgenden ethischen Leitlinien und der daraus abgeleiteten Grundsätze und Verfahren. Sie halten sich hinsichtlich ihrer humanitären Werte, ihrer psychotherapeutischen Grundsätze und ihrer beruflichen Verpflichtungen gegenüber Patienten, HIT-Mitarbeitern und der Öffentlichkeit an die in der Deklaration der UN und die im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland formulierten Menschenrechte.
Ethische Grundsätze des HIT
Die Aus- und Weiterbildungsteilnehmer des HIT sowie alle für das HIT arbeitenden Supervisoren, Lehrtherapeuten und Dozenten verpflichten sich zur Einhaltung folgender ethischer Grundsätze:
Regelungen zum Schutz von Patienten sind zugleich auf die im Rahmen eines Mehrpersonen-Settings einbezogenen relevanten Bezugspersonen der Patienten anzuwenden.
I. Allgemeines
1. Das HIT verpflichtet sich, in allen seinen Bereichen auf die Einhaltung ethischer und professioneller Standards für den psychotherapeutischen Beruf zu achten.
2. Die Arbeit von Psychotherapeuten steht im Dienste des therapeutischen Prozesses. Ziel des therapeutischen Prozesses ist die Heilung oder Linderung von seelischem Leiden. Im tiefenpsychologischen Sinne wird dies vor allem durch die Wiederherstellung, Förderung, Entwicklung und Reifung der Beziehung des Patienten zu sich selbst und zur äußeren Welt erreicht.
3. Es ist die Aufgabe der Psychotherapeuten, die psychotherapeutische Beziehung für die therapeutische Arbeit nutzbar zu halten. Dazu müssen sie die Grenzen des therapeutischen Raumes verlässlich und sicher herstellen und bewahren. Die Verantwortung dafür endet nicht mit der Beendigung der psychotherapeutischen Arbeitsbeziehung.
4. Voraussetzungen zum Erhalt der therapeutischen Kompetenz sind eine eigenverantwortlich gestaltete, die Berufspraxis begleitende und methodisch geleitete Reflexion der eigenen therapeutischen Arbeit, z.B. über Supervision, Intervision und Fortbildung. Psychotherapeuten achten darauf, ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten und sich körperlich und seelisch nicht zu überfordern.
5. Alle Genannten informieren sich regelmäßig über die rechtlichen Bedingungen ihrer Berufstätigkeit und unterliegen der Berufsordnung für Psychotherapeuten.
II. Spezielle ethische Grundsätze in der Psychotherapie mit Patienten
1. Psychotherapeuten achten jederzeit die Würde und Integrität ihrer Patienten.
2. Psychotherapeuten sind verpflichtet, den psychotherapeutischen Prozess durch Abstinenz zu sichern. Daraus folgt, dass sie niemals ihre Autorität und professionelle Kompetenz missbräuchlich dafür einsetzen, durch Patienten und deren Familie Vorteile für sich oder Dritte zu erzielen. Insbesondere nehmen sie keine sexuelle Beziehung zu Patienten auf. Sie achten das Abstinenzgebot auch über die Beendigung der psychotherapeutischen Arbeitsbeziehung hinaus.
3. Psychotherapeuten müssen während einer Psychotherapie und nach deren Ende das Ungleichgewicht der Macht zwischen Psychotherapeuten und Patienten gebührend berücksichtigen und dürfen nicht in einer Weise handeln, die der Autonomie des Patienten oder des ehemaligen Patienten entgegensteht.
4. Aggressives Handeln zerstört den psychotherapeutischen Prozess. Psychotherapeuten achten die Abstinenz, üben keine physische, psychische oder verbale Gewalt aus und drohen auch nicht damit. Sie berücksichtigen die bestehende asymmetrische Beziehung und nutzen diese nicht aus. Unangemessener Körperkontakt ist zu unterlassen, die körperliche Integrität ist jederzeit zu wahren.
5. Psychotherapeuten beachten die Informations- und Aufklärungspflicht gegenüber ihren Patienten. Dies gilt insbesondere für Diagnose- und Indikationsstellung, gewähltes Verfahren sowie für den psychotherapeutischen Behandlungsvertrag.
6. Mitteilungen der Patienten behandeln Psychotherapeuten stets vertraulich, auch über deren Tod hinaus. Die Diskretions-, Anonymisierungs- und Schweigepflicht gilt auch für folgende Situationen:
- wissenschaftliche Veröffentlichungen und andere Publikationen
- Supervisionen und kollegiale Beratungen
- bei eventuell eintretender Berufsunfähigkeit oder Tod des Psychotherapeuten sind im Hinblick auf alle Aufzeichnungen über Patienten vorsorglich Vorkehrungen zur Wahrung des Datenschutzes zu treffen
7. Die psychotherapeutische Behandlung eines Patienten ist freiwillig und der Patient kann die Psychotherapie jederzeit beenden oder eine andere Form der Unterstützung oder Rat einholen.
8. Psychotherapeuten achten darauf, ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Sie sollen sich körperlich und psychisch nicht überfordern. Wenn ein Psychotherapeut aufgrund von akuten Ereignissen oder Krankheit nicht über die notwendigen Kompetenzen oder Fähigkeiten verfügt, sollte er nicht weiter praktizieren. Er sollte in einem solchen Fall bereit sein, sich angemessen, zeitnah und umfänglich darum zu kümmern, seine Lage zu reflektieren und Hilfe zu suchen. Bei nicht absehbarer Genesung sollten laufende Therapien umsichtig beendet werden. Analog sollten Aus- und Weiterbildungsteilnehmer, die ihre ambulanten Stunden vollumfänglich geleistet haben, ihre ggf. noch laufenden Therapien angemessen abschließen bzw. vorausschauend eine anderweitige psychotherapeutische Weiterbehandlung bahnen.
9. Entscheidet sich ein Psychotherapeut für die vorzeitige Beendigung einer Psychotherapie, muss dies für den Patienten transparent gemacht werden und Alternativen entsprechend diskutiert werden.
10. Psychotherapeuten sind zu Fortbildung und Intervision, bei Bedarf zu Supervision und gegebenenfalls zu weiterer persönlicher Analyse bzw. Selbsterfahrung verpflichtet.
11. Die zuvor definierten Ethikleitlinien gelten auch für Online-Formate (Online-Psychotherapie in allen Setting-Formen).
III. Spezielle ethische Grundsätze in der psychotherapeutischen Aus- und Weiterbildung
1. Die ethischen Grundsätze in Ziff. II dieser Leitlinien beziehen sich ausdrücklich auf die Psychotherapie von Patienten. Psychotherapeuten müssen sich jedoch jederzeit bewusst sein, dass sie sich auch in Aus-, Weiter- und Fortbildungssituationen professionell verhalten müssen und auch dort den in Ziff. II genannten Einschränkungen unterliegen.
2. Zwischen Psychotherapeuten und Supervisanden oder Teilnehmern von Einzel- und Gruppenselbsterfahrung darf kein dienstliches, privates oder sonstiges Abhängigkeitsverhältnis bestehen.
3. Insbesondere achten Psychotherapeuten auf Abstinenz. Daraus folgt, dass sie niemals ihre Autorität und professionelle Kompetenz in der Aus-, Weiter- und Fortbildung missbräuchlich dafür einsetzen, durch ihre Supervisanden oder Teilnehmer von Einzel- und Gruppenselbsterfahrung und deren Familie Vorteile für sich oder Dritte zu verschaffen. Sie dürfen keine psychische, physische oder verbale Gewalt ausüben und auch nicht damit drohen. Sie berücksichtigen das bestehende Machtungleichgewicht und nutzen es nicht aus. Unangemessener Körperkontakt wird stets vermieden.
4. Psychotherapeuten nehmen keine sexuelle Beziehung zu ihren Supervisanden oder Teilnehmern von Einzel- und Gruppenselbsterfahrung auf. Im Hinblick auf Teilnehmer von Einzel- und Gruppenselbsterfahrung achten sie das Abstinenzgebot auch über die Beendigung der Arbeitsbeziehung hinaus.
5. Die Diskretions-, Anonymisierungs- und Schweigepflicht nach Ziffer II Abs. 6 gilt auch für Einzel- und Gruppenselbsterfahrungen. Das Non-Reporting System verbietet Auskünfte aus der Lehrtherapie gegenüber dem Institut.
6. Berichte aus Therapiesitzungen und Supervisionen sowie andere persönliche Mitteilungen über Aus-, Weiter- und Fortbildungsteilnehmer müssen strikt vertraulich behandelt werden. Sie dürfen ausschließlich von denjenigen benutzt werden, die in der konkreten Aus- und Weiterbildungssituation bzw. für die Aus- und Weiterbildung am Institut unmittelbar Verantwortung tragen. Die Nutzung von Material zu Forschungszwecken erfordert stets eine gesonderte Zustimmung.
7. Die Zusammenarbeit mit Kollegen innerhalb der Institution und mit anderen Institutionen ist geprägt von persönlichem Respekt und der Anerkennung von unterschiedlichen Haltungen zu Theorie und psychotherapeutischer Behandlungstechnik. Phantasien und Gerüchte müssen deutlich von beweisbaren Tatsachen unterschieden werden. Kritische Rückmeldungen sollen mit gebührender Sorgfalt, Offenheit und Achtung erfolgen. Wenn begründete Sorge und/oder Zweifel an der therapeutischen Kompetenz eines Kollegen bestehen, sollte dies zunächst dem Betreffenden mitgeteilt werden. Bei nicht möglicher Klärung sind zeitnah die Vertrauensleute des HIT einzubeziehen.
8. Bei der Beteiligung an oder der Leitung von wissenschaftlichen Forschungsprojekten und Veröffentlichungen halten sich Supervisoren, Dozenten und Aus- und Weiterbildungsteilnehmer an die wissenschaftlichen Regelungen und Standards. Dies gilt auch für schriftliche Veröffentlichungen von klinischem Material, die ggf. eine schriftliche Einwilligung der beteiligten Patienten benötigen. Supervisoren, Dozenten und Aus- und Weiterbildungsteilnehmer achten in Forschung und Publikationen auf die Rechte der Beteiligten (z.B. Einhaltung der Verschwiegenheitspflicht durch Anonymisierung aller Daten).
9. Werden für Lehre oder wissenschaftliche Zwecke Inhalte aus einer Psychotherapie verwendet, müssen alle Beteiligten Vertraulichkeit und Anonymität gemäß den Datenschutzrichtlinien wahren. Im Falle einer persönlichen Bekanntschaft oder eines Wiedererkennens von Material trotz Standardanonymisierung muss die Situation von der betroffenen Person verlassen und Stillschweigen bewahrt werden.
10. Die zuvor definierten Ethik-Leitlinien gelten auch für Online-Formate (z.B. Online-Supervision, Online- Therapiesitzungen und Online-Unterricht).
IV. HIT-Vertrauensleute | Definition und Tätigkeitsfeld der HIT-Vertrauensleute
Die HIT-Vertrauensleute sind Ansprechpartner bei Verdacht auf Verletzungen der Ethikleitlinien. Dem HIT gehören mindestens zwei Vertrauenspersonen an. Diese beiden Vertrauenspersonen dürfen nicht der HIT-Leitung angehören. Die HIT-Vertrauensleute arbeiten unabhängig von der HIT-Leitung. Der HIT-Vorstand ernennt mindestens zwei Vertrauensleute für einen Zeitraum von zwei Jahren.
Die Aufgaben dieser Vertrauenspersonen sind die Folgenden:
1. Sie sind Ansprechpartner für Patienten, Selbsterfahrungsteilnehmer, Aus- und Weiterbildungsteilnehmer sowie Supervisanden, die wegen möglicher Grenzüberschreitungen in Bedrängnis geraten sind, sowie für deren Angehörige. Sie sind ebenfalls Ansprechpartner für in ethischen Fragen Rat suchende Kollegen. Der Zuständigkeitsbereich der HIT-Vertrauensleute umfasst somit klinische Behandlungen, Tätigkeiten im Rahmen der Aus- und Weiterbildung, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die institutionelle und interkollegiale Zusammenarbeit.
2. Sie hören an, klären und fördern die Handlungsfähigkeit der Beschwerdeführenden bzw. Ratsuchenden. Sie nehmen dabei keine administrativ-judikative, sondern eine beratende, begleitende und empfehlende Funktion wahr. Die Vertrauensleute verpflichten sich, alle beteiligten Personen über ihre Arbeitsweise angemessen zu informieren.
3. Handlungsleitendes Ziel beim Umgang mit Informationen über dritte Personen ist eine Klärung mit den Betroffenen selbst. Sollten Beschwerdeführer oder Beklagte ihre Mitwirkung ablehnen, können die HIT- Vertrauensleute im persönlichen Gespräch in klärender Haltung Impulse geben – darüber hinaus werden sie nicht weiter tätig.
4. Es wird immer nur eine Vertrauensperson tätig.
5. Die Vertrauensleute unterliegen der Schweigepflicht. Eine Entbindung von der Schweigepflicht muss schriftlich erfolgen. Das gilt auch für den Austausch der Vertrauensleute untereinander (begrenzte Schweigepflichtentbindung).
6. Die Vertrauensleute treffen sich mindestens einmal jährlich zu einem Erfahrungsaustausch unter Wahrung des Schutzes der Anonymität aller Betroffenen. Sie regeln die Form ihrer Zusammenarbeit selbst.
7. Die HIT-Vertrauensleute müssen ggf., jedoch nur nach Schweigepflichtentbindung durch die Beschwerdeführer, entscheiden, ob Beschwerden an die HIT-Leitung weitergegeben werden. Erfolgt dies, überlegen Vertrauensleute und HIT-Leitung gemeinsam, ob zunächst das Schiedsgericht der DGPT, die Psychotherapeutenkammer/ Ärztekammer und im weiteren Verlauf ggf. der Ethikverein hinzugezogen wird, insbesondere wenn weitere Konsequenzen erforderlich sind.
8. Die Vertrauensleute berichten der HIT-Leitung mindestens jährlich schriftlich unter Wahrung der Schweigepflicht über Häufigkeit und Art ihrer Inanspruchnahme.
9. HIT-Vertrauensleute oder Mitglieder der HIT-Leitung sind von der Mitwirkung in einem Fall der möglichen Grenzüberschreitungen ausgeschlossen,
- wenn sie in der Sache selbst beteiligt sind.
- wenn sie mit Beschuldigten oder Beschwerdeführenden verheiratet, verwandt oder verschwägert sind oder waren.
- wenn sie in der Sache als Bezeugende oder Sachverständige vernommen worden sind oder werden könnten.
- wenn sie sich für befangen erklären oder ein Ablehnungsgesuch des Beschuldigten oder des Beschwerdeführenden wegen Besorgnis der Befangenheit für begründet erachtet wird. Die Selbstbefangenheit muss schriftlich und ausführlich begründet werden.
Maßnahmen des HIT im Fall möglicher Grenzüberschreitung
1. Die HIT-Leitung kann auf Anregung der HIT-Vertrauensleute bis zur Beschlussfassung durch das Schiedsgericht der DGPT bzw. Psychotherapeutenkammer/ Ärztekammer oder Ethikverein, einer beschuldigten Person die Lehr- und Weiterbildungsbefugnis (als Dozent, als Supervisor oder Lehrtherapeut) mit sofortiger Wirkung vorläufig entziehen, soweit dies zum Schutz der Patienten und Aus- und Weiterbildungsteilnehmer
erforderlich scheint. Im Falle von Verstößen gegen die Ethikleitlinien durch Weiterbildungsteilnehmer kann dies zur sofortigen Beendigung des Weiterbildungsverhältnisses bzw. zum vorläufigen oder endgültigen Entzug der vorläufigen Behandlungserlaubnis führen.
2. Die unter 1. beschriebene Befugnis steht der HIT-Leitung auch zu, wenn gegen die betroffene Person ein Schieds- und Ausschlussverfahren bei einem einschlägigen Berufsverband für Psychotherapeuten, Ärzten oder Psychologen anhängig ist. Gleiches gilt in Bezug auf Verfahren, die gegen die betroffene Person wegen Verletzung der Berufsordnung bei den zuständigen Kammern anhängig sind.
